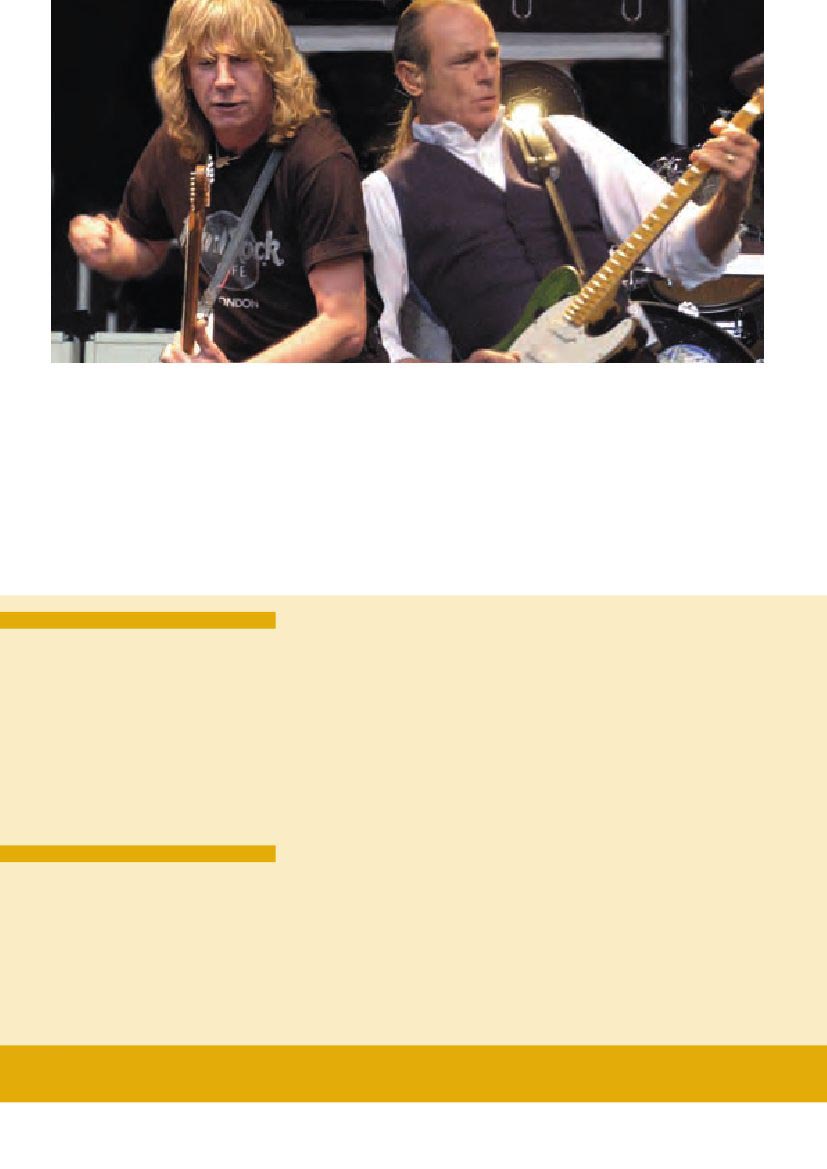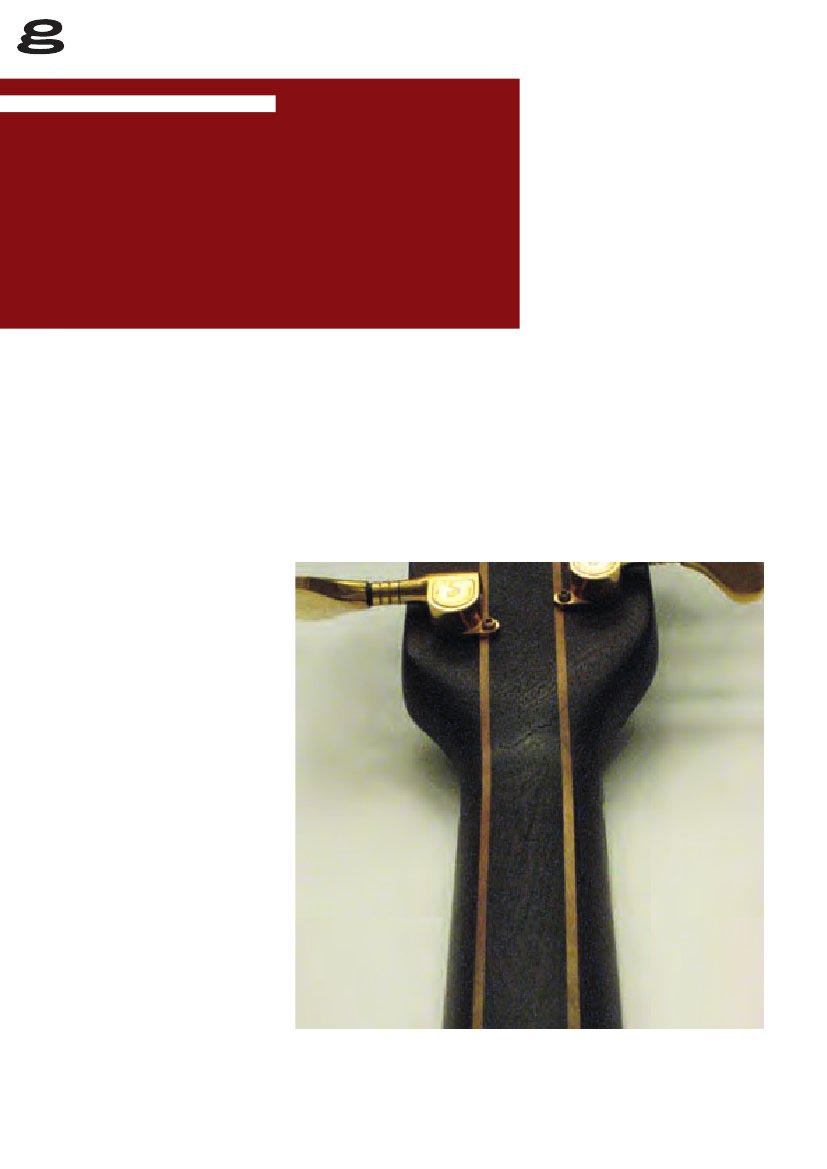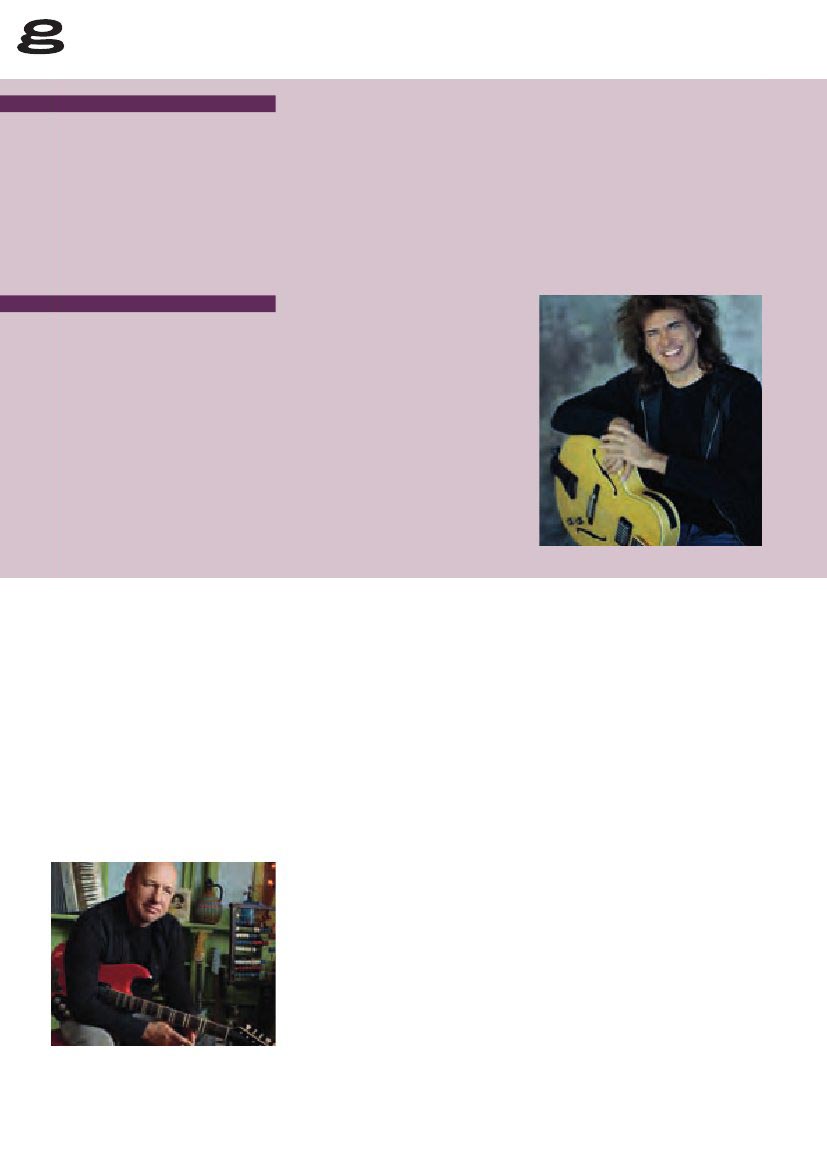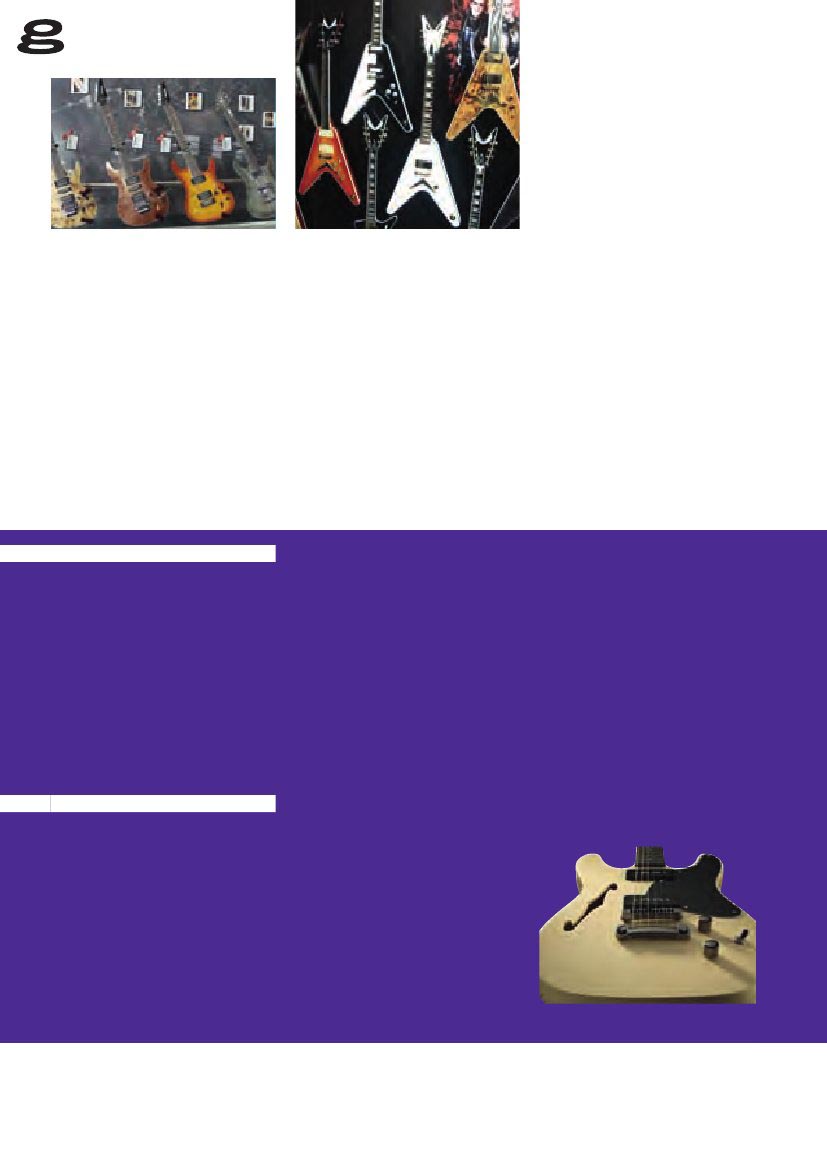Kaufberater e Gitarre
© PPVMEDIEN 2009
Diese Herren haben sich früh für ein Modell entschieden: Status Quo rocken seit Jahrzehnten mit ihren Telecasters
Der Weg zur richtigen Axt
Worauf man beim Kauf achten sollte
Zu den essenziellen Grundkenntnissen eines jeden Gitarristen gehören ein paar Basics in Sachen „ins-
trumentaler Anatomie“. Da der Ausgangspunkt unseres Sounds immer die Gitarre selbst ist, fangen wir
damit an und sehen uns zunächst mal an, was am Objekt der Begierde eigentlich dran ist.
Holz ist nicht gleich Holz
Da Bäume vor ihrer Verarbeitung Lebewesen sind,
existieren keine identischen „Werkstücke“. Selbst die
einzelnen Teile aus demselben Stamm können hinsicht-
lich ihrer Dichte, Zähigkeit und der Gleichmäßigkeit
des Wuchses abweichen. Diese Unterschiede machen
sich sowohl optisch wie klanglich bemerkbar. Daraus
folgt, dass der typische Klangcharakter, der einem
bestimmten Material zugeschrieben wird, nur als
eine Art Erfahrungs- oder Richtwert zu betrachten ist.
Es finden sich also mit Sicherheit auch Ausnahmen
von der „Regel“. Man sollte sich daher nicht völlig auf
ein bestimmtes Materialkonzept versteifen. Darüber
hinaus sind auch nicht alle Teile eines Baumstammes
zur Weiterverarbeitung als „Klangholz“ – also für den
Instrumentenbau – geeignet, was die Auswahl redu-
ziert. Das nächste Problem ist dann die Lagerung und
Trocknung. Aufgrund der industriellen Massenfertigung
kommt heute kaum noch luftgetrocknetes, also über
viele Jahre natürlich gelagertes Holz zum Einsatz. Es wäre
viel zu teuer und stünde auch gar nicht in den benötigten
Mengen zur Verfügung. Deshalb sind die Hersteller
schon seit Anfang der 70er Jahre dazu übergegangen,
industriell getrocknete Hölzer zu verarbeiten. Dabei
hängt die Materialqualität in hohem Maße von der
Beherrschung des Trocknungsprozesses ab. Jedenfalls
tun die Gitarrenproduzenten gut daran, die besten
Hölzer zu verwenden, die sie bekommen können. Denn
bei unsachgemäßer Trocknung und Lagerung kann sich
das Holz bei einem schlagartigen Klimawechsel noch
Jahre später verziehen, verdrehen oder reißen.
Schöner Schein
Manche Wuchsformen sehen besonders spektakulär
aus und werden deshalb häufig bevorzugt. Verständlich
– das Auge isst, besser gesagt: hört ja mit. (Leider sind
diese auch besonders anfällig für die zuvor genannten
Materialprobleme bei schnellem Klimawechsel.) Ahorn
beispielsweise zeigt gelegentlich eine getupfte, soge-
nannte Vogelaugenmaserung oder auch eine quer zur
Faser verlaufende „Riegelung“ (dies kommt auch bei
Hainbuche oder Koa und sehr selten sogar bei Esche
vor). Das heißt aber nicht, dass dieses „Birdseye -“
oder „Flamed Maple“ auch besser klingt als ein völlig
unauffälliges Holzstück. Eher im Gegenteil, denn die
„normalen“ Varianten sind in der Regel enger und ho-
mogener gewachsen, was dem Resonanzverhalten nur
zugutekommt.
Kein Geringerer als Leo Fender, Erfinder der industri-
ell gefertigten E-Gitarre, war ein Verfechter der These,
dass sich die „wilden“ Wuchsformen sowohl bei der
Bearbeitung als auch bei der Schwingungsentfaltung
eher unberechenbar verhalten. Deshalb zog er zeit-
lebens die optisch schlichteren Hölzer vor. Aber auch
unabhängig von solchen Äußerlichkeiten lohnt es sich
unbedingt, mehrere Exemplare des gleichen Modells
anzuspielen und miteinander zu vergleichen. Denn,
wie beschrieben, gibt es auch bei E-Gitarren immer
eine gewisse qualitative Streuung, ganz gleich, wie
penibel der Hersteller auch gearbeitet haben mag.
�
Gitarren Markt 2008/09
www.guitar.de
© PPVMEDIEN 2009
Hals-Spannstab-Abdeckung /
Trussrod Cover
Kopfplatte /
Headstock
Stimmmechaniken /
Tuner
Hals / Neck
Klemmsattel /
Locking Nut
Bünde / Frets
Griffbretteinlage / Inlay
Korpus / Body
Geleimter Hals /
Set Neck
Elektronikfach
Geschraubter Hals /
Bolt-on Neck
Korpushorn/
Cutaway
Gurtknopf /
Strap Pin
Tonabnehmerkappe /
Pickup Cover
Vibratohebel /
Whammy Bar
Tonabnehmerschalter /
Pickup Selector
Rahmen /
Mounting Ring
Vibratosteg /
Whammy-Bridge
Feinstimmer
Lautstärkeregler /
Volume Potis
Ausgangsbuchse
www.guitar.de
Gitarren Markt 2008/09
7
kaufberater e-gitarre
© PPVMEDIEN 2009
kaufberater e-gitarre
Hals-Spannstab-Abdeckung /
Trussrod Cover
Mensur /
Scale Length
Polschrauben /
Polescrews
Schlagbrett /
Pickguard
Tonabnehmerschalter /
Pickup Selector
Polschrauben /
Polescrews
F-Löcher /
F-Holes
Steg
Vibratohebel /
Whammy Bar
Deckeneinfassung /
Binding
Gewölbte Decke /
Archtop
Halbakustischer Korpus /
Semiacoustic Body
�
Gitarren Markt 2008/09
www.guitar.de
© PPVMEDIEN 2009
Geschraubter Hals mit ergonomischer Rundung bei Fender Stratocaster
Die richtigen Connections
Ob Jazz-Gitarre oder Metal-Axt, die wichtigsten Bestandteile einer Gitarre
sind in jedem Fall der Hals und der Korpus – aber mindestens ebenso
wichtig ist die Verbindung dieser beiden Elemente. Die prägt näm-
lich ganz entscheidend die Schwingungsübertragung und damit den
Klangcharakter des Instrumentes. Grundsätzlich gibt es drei Methoden:
1.) der Hals wird mit dem Korpus verschraubt, 2.) in den Korpus ein-
geleimt, oder es handelt sich 3.) um einen durchgehenden Hals, der
gleich bis zum Korpusende reicht (in diesem Fall sind die angeleimten
„Korpusflügel“ nur wenig am klanglichen Geschehen beteiligt).
Alle Bauformen haben ihre Vor- und Nachteile, die wir kurz beleuch-
ten wollen. Die traditionellste Methode ist die geleimte Hals-Korpus-
Verbindung, die seit Jahrhunderten bei Akustikgitarren angewandt wird.
Sie sorgt für guten Halt und eine gleichmäßige Schwingungsübertra-
gung, was sich in einem runden, kontrolliert ausklingenden Ton äußert.
Die Ausführung erfordert allerdings einiges handwerkliches Geschick
und verursacht daher entsprechend hohe Fertigungskosten.
Wesentlich simpler lässt sich eine Gitarre natürlich aus einzelnen
Korpus- und Halsmodulen „zusammenschrauben“. Dazu braucht man
nicht unbedingt einen gelernten „Luthier“, das können auch angelernte
Arbeiter. Als Leo Fender nach Möglichkeiten suchte, E-Gitarren kosten-
günstig in großen Stückzahlen herzustellen, war dies also die logische
Lösung. Selbstverständlich hat dies auch Auswirkungen auf den Klang.
Knackiger Sound vs. Monster-Sustain
Eine eingeschraubte Halsverbindung überträgt die Schwingungen nicht
so homogen wie die traditionelle, verleimte Version. Dadurch werden die
Ausklingphase kürzer und der Anschlag prägnant herausgestellt. Das ist
aber kein Mangel, sondern für perkussive Spielweisen wie Funk, Country,
knackiges Riffing oder auch schnelles Solospiel unter Umständen ideal.
Die dritte Möglichkeit ist, Hals und Korpus von vornherein als kons-
truktionelle Einheit zu betrachten. Der Halsstreifen endet also nicht am
Übergang zum Body, sondern setzt sich einfach fort und bildet selbst das
Mittelstück. Daran leimt man dann seitlich zwei Korpusflügel an, um die
gewünschte Korpusform zu erhalten. Bei dieser Version sind der Hals und
seine Konstruktion der Klang bestimmende Faktor.
Damit sich das Holz auf der gesamten Länge nicht verzieht, wählt man
hierfür entweder besonders harte, ausgesuchte Materialien oder arbeitet
mit mehreren gegenfaserig verleimten Holzstreifen. Auch diese Methode
ist sehr arbeitsintensiv und teuer. Die wesentlichen Vorteile sind ein au-
ßerordentlich langes Sustain und die Möglichkeit, den Übergang zum
Korpus extrem fließend zu gestalten. So kann die Greifhand den gesamten
Spielbereich problemlos erreichen, was bei der geschraubten oder geleim-
ten Hals-Korpus-Connection nur mit erheblichem Aufwand zu erzielen ist.
www.guitar.de
© PPVMEDIEN 2009
Harte Hölzer für starke Hälse
Der Hals besteht normalerweise aus einem Hartholz,
das dem Saitenzug problemlos und für lange Zeit
standhalten muss. Ahorn beispielsweise ist ein
sehr helles, zähes und relativ schweres Holz, das
einen knackigen drahtigen Ton unterstützt. Als
Halsmaterial für E-Gitarren ist es weltweit allererste
Wahl, gefolgt von Mahagoni.
Das ist eigentlich ein Familienbegriff für zahl-
reiche ähnliche Arten, die meistens aus Afrika oder
Südamerika stammen. Diese tropischen Hölzer sind
etwas weicher, normalerweise von mittelbrauner
Farbe und klingen weniger direkt, sondern weicher
und mittiger. Einige Hersteller verbauen in jüngster
Zeit allerdings auch immer häufiger Hälse aus „echten
Harthölzern“ wie Palisander (etwa bei PRS und gele-
gentlich sogar Fender) oder Ovangkol (Framus).
Damit lässt sich ein druckvoller und trotzdem
sehr präziser Ton erzielen, der den Instrumenten,
zumindest unverstärkt, einen modernen, knalligen
Klangcharakter aufprägt, der gewissermaßen am
gegenüberliegenden Ende der Vintage-Sound-Skala
angesiedelt ist.
Nie den Hals riskieren …
Damit wird schon klar, dass man beim Gitarren-
Shopping zuallererst auf den Hals achten sollte.
Zu prüfen ist zunächst, ob dieser sauber in den
Korpus eingesetzt wurde. Eine klaffende Lücke
zwischen „Halstasche“ (die Fräsung im Korpus,
die den Hals aufnimmt) und „Halsstock“ (der
untere, etwas breitere Teil des Halses) bei einer
geschraubten Verbindung ist zu verschmer-
zen, wenn die Schrauben stramm angezogen
sind und sich das Ganze nicht hin- und herbe-
wegen lässt. Falls hier etwas wackelt, heißt es
Schrauben nachziehen, und wenn auch das
nicht hilft, lasst lieber die Finger von dieser
Gitarre.
Auch ein eingeleimter Hals sollte sich
natürlich nicht so einfach bewegen lassen.
Tut er es doch, ist womöglich die verleimte
Verbindungsfläche zu klein (was auch dem
Sound abträglich ist) oder das Halsmaterial zu
weich. Ein weiteres Indiz, das einen stutzig ma-
chen sollte, sind kleine Lackrisse oder Bläschen
an den Rändern, wo Hals und Korpus aufein-
ander treffen. Das könnte nämlich darauf hin-
deuten, dass da etwas in Bewegung geraten
ist, was eigentlich bombenfest halten sollte.
Das muss nicht so sein, kann aber, also ist hier
Vorsicht angebracht.
Ein ganz kritischer Punkt ist schließlich der
Übergang zur Kopfplatte. Vor allem bei nach
hinten abgewinkelten Ausführungen (die brin-
gen den meisten Druck auf den Sattel und da-
mit die beste Schwingungsübertragung) oder
auch geraden „Headstocks“ mit Klemmsattel
bleibt hier nicht mehr allzu viel Material stehen,
zumal hier ja meistens auch noch die Fräsung
für die Hals-Spannstab-Schraube zu Buche
schlägt. Da genügt ein winziger Materialfehler
oder ein unglücklicher Stoß, und es entsteht
ein Riss. Gerade an dieser konstruktionel-
len „Sollbruchstelle“ wirken aber die größ-
ten Zugkräfte. Insofern ist ein geschwächter
Kopfplattenansatz ein klassischer K.o.-Faktor
beim Gitarrenkauf. Haltet das Instrument am
Hals, so dass ihr die Rückseite seht, und drückt
ganz leicht gegen die Spitze der Kopfplatte.
Fühlt ihr dabei deutliches Spiel oder zeigen
sich sogar Risse, stellt ihr das Instrument besser
gleich wieder zurück in den Ständer.
… und immer schön „straight“ bleiben
Außerdem sollte der Hals natürlich nicht
krumm oder verzogen sein. Um das festzustel-
len muss man kein Experte sein. Man merkt es
beim Spielen, wenn die Saitenlage nur in be-
stimmten Bereichen unangenehm hoch oder
niedrig erscheint oder bestimmte Töne nicht
sauber schwingen können, sondern gleich
absterben. In solchen Fällen: Lasst den Hals
vom Händler nachjustieren. Eine übermäßige
Krümmung nach hinten oder vorn kann immer
mal vorkommen und lässt sich eigentlich pro-
blemlos korrigieren.
Genau dafür ist schließlich der Spannstab
im Hals zuständig. Es kann allerdings einige
Stunden oder sogar einen Tag lang dauern,
bis das Kräfteverhältnis zwischen Hals und
Saitenzug wieder in der Balance ist. Habt ihr
also ein ganz bestimmtes Instrument im Auge,
kommt lieber noch mal am nächsten Tag wie-
der, wenn sich der Hals wieder „beruhigt“ hat.
Stellt sich durch diese Maßnahme aber keiner-
lei Verbesserung ein, und es scheppert immer
noch an allen Ecken und Enden, ist der Hals
höchstwahrscheinlich verzogen, sprich: in sich
verdreht – oder aber die Bünde sind ungleich-
mäßig eingesetzt oder haben sich teilweise
gelöst, was auch nicht besser ist. In jedem Fall
bedankt man sich für die Mühe und greift doch
besser zu einem anderen Exemplar.
Nicht immer einfach zu erkennen: Der Riss bedeutet eine angeknackste Kopfplatte
www.guitar.de
10
Gitarren Markt 2008/09
© PPVMEDIEN 2009
Hollowbody-Gitarren
Eine wichtige Instrumentenunterart kombiniert
Elemente von akustischer und elektrischer Gitarre und
erzeugt damit einen Sound, der irgendwo zwischen
diesen Welten liegt. (Wir sprechen jetzt allerdings nicht
von modernen elektroakustischen Instrumenten, deren
Aufgabe darin besteht, einen möglichst natürlichen
„Akustik-Sound“ über Verstärker und auch noch in lau-
ter Umgebung zu simulieren.)
Die Anfänge dieses Evolutionsstranges reichen noch
bis in die 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts
zurück. Damals begann man, die auf akustische
Lautstärke getrimmten „Archtops“ (engl. für „gewölbte
Decke“ – im Gegensatz zur „Flattop“, der normalen
Akustikgitarre), also große und dicke Akustikgitarren
mit schmalen F-förmigen Schalllöchern, mit mag-
netischen Tonabnehmern auszurüsten. Andere
Tonabnehmersysteme gab es noch nicht, und das
Ergebnis war nun nicht unbedingt ein akustischer,
sondern ein neuartiger „elektrischer“ Gitarren-Sound.
Da man dank der Verstärker nicht mehr die maximale
akustische Lautstärke brauchte, gingen die Hersteller
mehr und mehr dazu über, statt massiver, aufwändig
geschnitzter Hölzer wesentlich preisgünstigere ge-
sperrte Furnierhölzer zu verbauen.
Für Feedback-Experten
Schichthölzer lassen sich leichter in die gewünschte
Form bringen. Außerdem neigen sie, gerade weil
sie nicht so resonanzfreudig sind, nicht so leicht zu
Rückkopplungen, die bei diesem Gitarrentypus ja im-
mer ein Thema sind. Schließlich reduzierte man auch
noch das Korpusvolumen, um das Feedback-Risiko
zu verringern. Diese Variante nannte man „Thinline-
Body“, was aber nicht mit den späteren „Thinline“-
Gitarren à la Fender zu verwechseln ist (die eigentlich
nur Solidbodys mit zusätzlicher Resonanzkammer
sind). Ob dick oder dünn, all diese Instrumente wer-
den wegen des hohlen Korpus – mit Zargen, Boden
und Decke wie bei einer Akustischen – „Hollowbodys“
genannt und bis heute gespielt. Im Jazz- (Charlie
Christian, Wes Montgomery, Joe Pass, George Benson,
Jimmy Bruno, Pat Metheny usw.) und teilweise auch
im traditionsbewussten Blues- (T-Bone Walker) oder
Rockabilly-Bereich (Scotty Moore bis Brian Setzer) ge-
hören sie praktisch zum Standardinstrumentarium.
Bei hoher Lautstärke und einer gewissen
Übersteuerung ist so eine komplett „hohle“ Gitarre
allerdings kaum noch zu kontrollieren. Dennoch gibt es
auch einige todesmutige „Rocker“, die darauf stehen,
Yes-Gitarrist Steve Howe mit seiner berühmten Gibson
ES-175 etwa oder Feedback-Experte Ted Nugent mit
seiner nicht minder legendären „Byrdland“.
Berühmter Hollowbody-Spieler der Gegenwart: Pat Metheny
Wo wir gerade von Bünden sprechen: Man
muss sich beim Spielen wohlfühlen – und den
innigsten Kontakt hat die Greifhand mit Hals
und Griffbrett. Daher sollten diese Spielzone
selbst und auch die Bünde schön glatt geschlif-
fen, gleichmäßig abgerichtet und poliert sein.
Fährt man einfach nur mal mit der flachen
Hand über die Griffbrettoberfläche, spürt man
häufig schon, ob der Feinschliff gelungen ist
oder nicht. Ganz wichtig fürs Spielgefühl sind
außerdem die Griffbrettkanten und Bund-
enden. Ein schlecht entgrateter Bunddraht
Normalerweise mit Stratocaster: Mark Knopfler
kann sogar zu Verletzungen beim Spielen füh-
ren! Ungleichmäßig hohe Bünde sind nicht
unbedingt so leicht auszumachen. Sie äußern
sich meist in schnarrenden Tönen, die nur auf
einzelnen Saiten und/oder bestimmten Lagen
des Griffbretts auftreten. Da muss man schon
genau aufpassen. Allerdings kommt so etwas
bei neuen Instrumenten nur selten vor.
Geschmackssache
Bei Second-Hand-Schnäppchen, bei denen
die Bunddrähte (engl.: frets) schon einige
„Kilometer“ hinter sich haben, sieht das unter
Umständen ganz anders aus. Kein sicheres Indiz
für einen missratenen „Fretjob“ sind übrigens
verstimmt klingende Akkorde. Möglicherweise
ist nur die Oktavreinheit am Steg nicht korrekt
eingestellt (mehr dazu im Abschnitt Hardware),
oder die Bünde sind recht hoch und die eigene
Spieltechnik ist an flachere gewöhnt. Da drückt
man die Finger schnell mal zu fest auf, und
schon klingen die Akkorde schief. Dafür kann
die Gitarre natürlich nichts.
Auch sonst gehören –
räusper
– intime Details
wie Bundformat, Griffbrettmaterial und Form
sowie Halsquerschnitt zur häufig schwierigen
Kategorie „Geschmackssache“. Solo-Piloten,
Sweep-Picker und Tapping-Spezialisten fühlen
sich meist auf eher dünnen, breiten, möglichst
unlackierten Hälsen und flachen Griffbrettern
mit kräftigen Jumbobünden heimisch.
Ganz anders bekennende Blueser oder
Rootsrocker, die ein wesentlich dickeres,
rundes Halsprofil mit flacheren Bünden be-
vorzugen, sich dafür aber an einer lackierten
Halsrückseite nicht weiter stören. Dann gibt es
wiederum Spieler, die für eine optimale Führung
ihrer Greifhand einen klassischen V-förmigen
Halsquerschnitt brauchen. Ähnlich verhält es
sich mit den Griffbretthölzern: Der eine mag
Palisander, weil es auch in schweißtreibenden
Momenten griffig bleibt, ein anderer besteht
auf das besonders feinporige Ebenholz.
Und für den nächsten muss es Ahorn sein,
wobei dann noch zu klären wäre, ob nur geölt/
gewachst oder lackiert. Ersteres fühlt sich, wie
bei der unlackierten Halsrückseite, besser an,
das zweite ist haltbarer und schützt das Holz
besser vor Abrieb und unschönen Spielspuren.
Den Fans von ab Werk vermackten, „pre-aged“
oder „reliqued“ Gitarren kann es hingegen gar
nicht abgespielt genug aussehen.
www.guitar.de
12
Gitarren Markt 2008/09
© PPVMEDIEN 2009
Ganz praktische Erwägungen bestimmen un-
sere weiteren Auswahlkriterien: Wie auch im-
mer der Korpus aussehen oder geformt sein
mag, er sollte angenehm am Körper anliegen
und in der bevorzugten Spielhaltung keine
Probleme bereiten.
Heavy Guitars & Hardware
Eine Flying V oder ähnlich extrovertierte
Formen sind zum Beispiel eher nicht zum
Spielen im Sitzen geeignet. Auch sollte das
Gewicht nicht zu hoch sein. Eine besonders
massige Solidbody kann schon mal 5 kg wie-
gen und hat aufgrund der schieren Masse si-
cher ein stabiles Sustain. Aber wer regelmäßig
mehrstündige Gigs überstehen muss, wird da-
mit bestimmt nicht froh.
Damit man möglichst lange Freude
am Instrument hat, sollte natürlich auch
die Hardware von guter Qualität sein. Die
Stimmmechaniken müssen exakt und fest
angebracht sein, die Brücke muss rappel-
frei und am richtigen Fleck sitzen, und die
Endpins dem Gurt sicheren Halt gewähren.
Übermäßig scharfe Ecken und Kanten darf eine
Bei Ibanez wird auch die Heavy-Gemeinde fündig
Die typisch metalmäßige V-Form
Kleine Griffbrettkunde
Noch ein paar allgemeine Hinweise zum
„Fretboard“. Den kompaktesten und knackigs-
ten „Draht-Sound“ liefern Ahorngriffbretter,
egal ob separat aufgesetzt oder als One-piece-
Neck. Ein Griffbrett aus Palisander (engl.
„Rosewood“, was übrigens botanisch über-
haupt nichts mit dem heimischen Rosenstock,
sondern nur mit dem Geruch des frisch ge-
schnittenen Tropenholzes zu tun hat) liefert
einerseits brillantere Höhen, aber gleichzeitig
auch fettere Mitten, die den Ton milder und
runder klingen lassen. Ebenholz unterstützt ei-
nen ähnlich „breiten“ Sound wie Palisander, ist
aber unten herum definierter und wirkt in den
Höhen recht scharf und präsent.
Die übrigen Spezialfälle wie One-piece-Neck
(Hals und Griffbrett aus einem Stück), Slabboard
(besonders dickes Palisandergriffbrett mit pla-
ner Unterseite) oder Maple-Cap (separat aufge-
leimtes Ahorngriffbrett) wollen hier mal außen
vor lassen. Wissen sollte man aber noch, dass
Ahorn ohne regelmäßige Pflege sehr schnell
„verdreckt“. Tropische Hölzer, zu denen eben
auch Palisander und Ebenholz gehören, hin-
gegen müssen zumindest ab und zu geölt wer-
den. Tut man das längere Zeit nicht, können sie
austrocknen und sogar reißen.
Keine halben Sachen
Ende der 50er Jahre erfand Gibsons damaliger Chef-
Designer Ted McCarty, auf dessen Konto übrigens auch so
geniale Solidbody-Entwürfe wie Les Paul, Explorer und
Flying V gehen, eine neue Gitarrengattung: die halb-
akustische (engl. semi-acoustic) ES-335. Dabei handelte
es sich zunächst um eine „Hollowbody“ mit F-Löchern
und allem Drum und Dran – allerdings mit einem zusätz-
lichen, im Inneren verborgenen, massiven Holzblock, der
vom Halsfuß bis zum Korpusende (manchmal auch nur
bis unter den Steg) reichte. Dieser sogenannte „Sustain-
Block“ sorgt, wie der Name schon sagt, für eine wesent-
lich längere Ausschwingphase, wie man sie sonst nur von
massiven „Brettkonstruktionen“ kennt, und reduziert
noch einmal deutlich die Feedback-Anfälligkeit.
Gleichzeitig bewahrt das Instrument durch die
aufwendige Konstruktion auch einen perkussiven,
„akustischen“ Touch. Natürlich ist die Bauweise dadurch
auch teurer als die klanglich verwandten Solidbodys. In
Sachen Sound ist so eine Semiacoustic eigentlich fast
überall einsetzbar, fühlt sich aber insbesondere im Jazz
(John Scofield, Larry Carlton, Lee Ritenour), Blues (B. B. &
Freddie King, John Lee Hooker …) oder ursprünglichem
Rock’n’Roll (Chuck Berry, Bo Diddley) zu Hause. Auch
lauten, lärmenden Rock verkraftet dieser Gitarrentyp
spielend, was schon der junge Pete Townshend (The
Who), die Beatles John Lennon und George Harrison
(auf Rickenbacker), Woodstock-Legende Alvin Lee (mit
Ten Years After) oder Rushs Alex Lifeson eindrucksvoll
demonstrierten.
Und nicht nur bei Pop-Ikonen wie Peter Weller oder
Johnny Marr, sondern auch bei Bands der dritten und
vierten Generation von Oasis bis The Killers sieht und
hört man die Semiacoustics sehr häufig.
Semi-Acoustic oder Semi-Solid?
Ende der �0er machte man sich im Hause Fender
auch einige Gedanken zum Thema „Luft im Bauch“
und ersann schließlich die „Thinline-Telecaster“.
Eigentlich war das eine ganz normale massive Gitarre,
nur hatte man in der oberen Korpushälfte eine große
Resonanzkammer hineingefräst, das Ganze dann ver-
schlossen und mittels F-Loch auf der Decke kenntlich
gemacht. Diese „Semi-Solidbody“ nähert sich also
gewissermaßen von der anderen Seite.
In den letzten Jahren hat diese Konstruktion erneut
viele Nachahmer gefunden und ist mittlerweile über-
raschend weit verbreitet. Solche Instrumente (mit und
ohne F-Löcher) findet man unter anderem im Sortiment
von Tom Anderson, ESP, Fender, Framus, Hamer, Ibanez,
PRS oder auch Yamaha.
Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Der luftige,
perkussive Klangcharakter ähnlich einer Semiacoustic
ist somit viel einfacher und kostengünstiger herzu-
stellen. Die Instrumente sind angenehm leicht und
aufgrund ihrer etwas „solideren“ Bauweise dennoch
nicht so empfindlich wie die aus dünnen Schichthölzern
gebaute Konkurrenz.
Thinline-Telecaster, erkennbar am F-Loch
14
Gitarren Markt 2008/09
www.guitar.de
© PPVMEDIEN 2009
Hybridgitarren
In jüngster Zeit hat sich auf dem Markt eine weitere, noch relativ junge Gattung
etabliert, die sogenannte Hybridgitarre. Egal, welcher bekannte Gitarrentyp hier-
für als Ausgangsbasis dient, der eigentliche Clou versteckt sich in der Elektronik.
So gibt es E-Gitarren, die neben der normalen Tonabnehmerbestückung ein
Piezosystem an Bord haben, um damit (überraschend authentisch) eine verstärkte
Akustikgitarre zu simulieren. Angefangen hat diese Entwicklung bei traditionellen
Instrumenten wie Hamers Duotone oder Godins legendärer Acousticaster, gefolgt
von extrovertierten Hightech-Designs à la Parker Fly.
Mit dem Aufkommen von speziellen Piezo-Brücken, hexaphonischen MIDI-
Pickups und digitalem Modeling eröffnen sich experimentierfreudigen Gitarristen
hier noch ganz andere Möglichkeiten. Die Line 6 Variax etwa simuliert recht
authentisch den Klang ganz unterschiedlicher Gitarrentypen, ebenso wie die noch
relativ neue Fender VG Stratocaster. Daneben gibt es auch noch einige interessan-
te Hybridmodelle von Altmeister Robert Godin, die von „Acoustic-Sound“ bis MIDI-
Synthgitarre alles abdecken. Mittlerweile gibt es aber auch noch einen weiteren
interessanten Trend. Taylors T5 zum Beispiel ist vom Konzept her eine elektroakus-
tische Gitarre für die Bühne, die zusätzlich auch magnetische Tonabnehmer an
Bord hat, um eben auch als E-Gitarre (zumindest für dezentere Sounds wie Jazz,
Pop oder Blues) zu fungieren. Das alles kann recht verwirrend sein. Daher sollte
man sich bei konkretem Interesse sehr genau damit auseinandersetzen. Wirklich
Sinn ergeben solche speziellen „Alleskönner“ natürlich für gut gebuchte Top-
40-Gitarristen, die mit einem einzigen Instrument möglichst alle erdenklichen
Gitarren-Sounds abdecken müssen. Aber auch da gilt es, sehr genau zu prüfen,
welche Sound-Optionen man tatsächlich braucht.
Regius 7
Transparent Black
Handmade in Europe
Die Regius 7 verfügt über eine zusätzliche tiefe H-Saite für
gewaltige Sound-Fülle. Mit der durchgehenden Halskon-
struktion, Sumpfeschekorpus und Riegelahorndecke bietet
sie eine tolle Optik. 2 Seymour Duncan Humbuckern und
ausgesuchte Hardware, feinster Verarbeitung sorgen für
super Sound. Bis ins feinste Detail ist die Regius 7 wie ihre
Schwestern aus der Regius Serie ein absolutes High End In-
strument für höchste Ansprüche zu einem mehr als fairen
Preis!
• 7-String mit tiefer H-Saite
• Sumpf Esche Korpus
• geflammte Ahorn Decke
• 11-teiliger Neck-Thru-Body Hals aus Ahorn, Mahagoni,
Wenge und Amazaque
• Ebenholz Griffbrett
• 24 Medium-Jumbo-Bünde
• 2 Seymour Duncan Invader Humbucker
• Multi-Bindings an Korpus,
Hals und Kopfplatte
• GraphTech Sattel
• Locking Mechaniken
• ABM Fixed Bridge (String-Thru-Body)
• Schaller SecurityLocks
• Finish: Transparent Black
• inkl. Case
Deutscher Old-School-Metal mit entsprechendem Werkzeug: Gitarrenfraktion der Scorpions
Aaron Aedy
PARADISE LOST
Brückenkonstruktion nicht haben, da man beim Spielen ja gerne mal die
Anschlagshand darauf ablegt. Das könnte sonst schnell unangenehm
werden. Einige feste Brücken im Tele-Style sind diesbezüglich häufig
problematisch. Das gilt es also zu prüfen.
Hat das Instrument dagegen ein Vibratosystem, sollte dieses so jus-
tiert sein, dass sich die Gitarre beim Benutzen des „Whammy-Bars“ mög-
lichst wenig verstimmt. (Da schadet auch ein Blick auf den Sattel nicht,
denn sind die Kerben für die Saiten zu eng oder zu tief gefeilt, gibt es na-
türlich Probleme.) Auch sollte der Hebel selbst nicht hilflos herumschla-
ckern. Bei traditionellen Vibratos im Vintage-Style muss man diesbezüg-
lich gewisse Abstriche in Kauf nehmen.
Ein modernes Locking-System à la Floyd Rose, noch dazu mit Klemm-
sattel, sollte allerdings im wahrsten Sinne des Wortes reibungslos
und verstimmungsfrei funktionieren. Sonst ist es sein Geld nicht wert.
Insofern sollte man sich auch gut überlegen, ob man sich ein beson-
ders preisgünstiges „Schnäppchen“ zulegt, bei dem die Hälfte der
Produktionskosten allein für die Hardware draufgeht. Man kann sich
leicht vorstellen, welche Qualitätsstufe dann wohl noch für die übrigen
Bauteile übrig bleibt.
© PPVMEDIEN 2009
– im Prinzip wie eine Humbucker-Schaltung,
nur eben ohne den typischen Klangcharakter
zu verlieren. So herrscht zumindest in den
„Zwischenpositionen“ des Pickup-Schalters,
also beim Parallelbetrieb zweier Singlecoils,
Ruhe. Die Einzelpositionen brummen aber
nach wie vor.
Pickup-Typen und Sound-Optionen
Ganz grob eingeteilt, eignen sich typische
Singlecoils besonders gut für cleane (gerne
auch mit Effekten angereicherte sphärische)
bis leicht übersteuerte, „angerotzte“ Sounds,
wie man sie bei Country, Funk, Pop oder
Blues antrifft. Alle übrigen Typen vom P90
bis zum Fullsize-Humbucker sind dann eher
für deftigere und verzerrte Sounds optimal
(obwohl man sie im Jazz natürlich auch clean
einsetzt, aber hier hat man auch völlig ande-
re Klangvorstellungen). Grundsätzlich gilt: Je
fetter und lauter der Tonabnehmer überträgt,
desto mehr Verzerrung verträgt er. Zwar ha-
ben Jimi Hendrix oder Ritchie Blackmore und
ihre zahlreichen musikalischen Nachkommen
bewiesen, dass man auch mit Singlecoils teuf-
lisch abrocken kann, aber im Hardrock oder gar
Metal-Bereich findet man sie doch eher selten.
Aktive Power
Eine Sonderform stellen dann noch die aktiven
Pickups dar. Dabei handelt es sich unabhän-
gig von der äußeren Bauform um niederoh-
mige Humbucker, die direkt mit einer aktiven
Verstärkungselektronik gepowert werden.
Diese Teile liefern einen besonders breiten
Frequenzgang mit viel Punch und einer leich-
ten Kompression.
Damit eignen sie sich ebenfalls bestens
für glasklare „Effekt-Sounds“ (think David
Gilmour) und insbesondere für stark verzerrte
Amp-Einstellungen. Deshalb findet man sie
im Metal-Bereich praktisch an jeder Ecke, von
Harte Gitarren für harten Sound: Richard Z. Kruspe (Rammstein) setzt auf ESP
Onboard-Elektronik
Die Gitarrenelektronik (Tonabnehmer, Schal-
ter, Regler usw.) überträgt nicht einfach nur
neutral das Signal zum Verstärker, sondern
greift teilweise massiv und Klang formend ein.
Natürlich „klingt“ ein Pickup nicht selbst, aber
er wirkt im Zusammenwirken von Reglern
und Instrumentenkabel, vereinfacht aus-
gedrückt, wie ein komplexer Frequenzfilter
und begünstigt dadurch einen bestimmten
Klangcharakter. Herkömmliche Singlecoils et-
wa übertragen ein transparentes Klangbild, mit
guter Dynamikabbildung und vielen Höhen.
Humbucker liefern ein breites, fette-
res und dafür weniger bissiges Signal. Und
Sonderformen wie Soapbar (auch P90 ge-
nannt) oder Mini-Humbucker und derglei-
chen liegen klanglich irgendwo dazwischen.
Da hilft letztlich nur das eigene Antesten, um
herauszufinden, was einem am besten liegt.
Allerdings sollte man immer im Hinterkopf
behalten, dass der gleiche Tonabnehmer in
einer anderen Gitarre unter Umständen völlig
andere Klangergebnisse liefert. Wie gesagt, der
Pickup klingt ja nicht selbst, er filtert nur das
angebotene akustische Signal.
Brummen im Hintergrund
Konstruktionsbedingt
lassen
sich
bei
„Einspulern“, also den typischen schmalen
Singlecoils und den breiten P90-Typen, elek-
tromagnetische Einstreuungen nicht ganz ver-
meiden. Ein gewisses „Hintergrundbrummen“,
vor allem bei übersteuertem Verstärker, ist
völlig normal. Zwar gibt es auch „brumm-
freie Singlecoils“, die technisch betrachtet
Humbucker sind und mit aufwendigen Tricks
versuchen, den Brumm zu beseitigen und den
originalen Klang trotzdem zu erhalten. Aber
sie sind in der Regel teuer und liefern auch
nicht in jedem Fall den gewünschten offenen
und perligen Sound. Das kommt dann auch
wieder sehr auf die akustischen Eigenheiten
der Gitarre und das übrige Equipment an. Die
meisten Gitarristen arrangieren sich daher lie-
ber mit dem Singlecoil-Brumm, und meistens
funktioniert das auch.
Umgekehrt gewickelt
Sehr hilfreich sind in diesem Zusammenhang
die sogenannten RW/RP-Pickups (Reverse
Wound/Reverse Polarity), die man bei vielen
Instrumenten vorfindet. Diese sind umge-
kehrt gewickelt und magnetisiert, so dass sie
beim Zusammenschalten mit einem „norma-
len“ Singlecoil Nebengeräusche eliminieren
Bastelte seine Traumgitarre selbst – und legte den Grundstein für eine ganze Generation: Eddie Van Halen
1�
Gitarren Markt 2008/09
www.guitar.de
© PPVMEDIEN 2009
Joe Satriani steht seit langem auf Ibanez-Modelle
Zakk Wylde (der seine Les Pauls grundsätzlich
mit EMG-Pickups bestückt) bis Dave Mustaine
(der Seymour Duncans Aktiv-Set bevorzugt).
Wer hingegen eher auf traditionellere Sounds
mit weniger Gain steht, ist vermutlich mit her-
kömmlichen passiven Humbuckern, die einen
offeneren und runderen Sound übertragen,
besser dran.
Um mehr klangliche Vielfalt herauszuho-
len, sind viele Gitarren auch mit einer Mixtur
aus Humbucker und Singlecoil versehen. Sehr
häufig findet sich ein kraftvoller Humbucker in
der Stegposition, gepaart mit zwei Singlecoils;
manchmal sind es auch zwei Doppelspuler
mit einem Singlecoil in der Mitte. Besonders
effektiv sind solche Bestückungen, wenn
die Humbucker im Parallelbetrieb mit einem
Singlecoil gesplittet werden. Dabei wird eine
Spule kurzgeschlossen, und sie funktionieren
und klingen dann wie ein Singlecoil (zumin-
dest so ähnlich). Ibanez hat dieses Prinzip
Mitte der 80er Jahre mit der JEM-Gitarre für
Steve Vai etabliert. Seitdem ist das zu einer Art
Industriestandard geworden.
Clevere Verschaltung
Viele Hersteller machen sich die Splitmöglich-
keit der Humbucker zunutze und verzichten
dabei ganz auf einen zusätzlichen „echten“
Singlecoil. Auch mit einer cleveren Verschaltung
zweier Doppelspuler lässt sich eine breite
Klangpalette erzielen, was zum Beispiel PRS
auch schon seit über 20 Jahren eindrucksvoll
vorführt. Entscheidend für den Anwender,
sprich Musiker, ist allerdings, dass sich die
ganze Fülle an Sounds in der Praxis auch ver-
nünftig bedienen lässt. Dafür gibt es immer
verschiedene technische Möglichkeiten.
Daher sollte man sich Instrumente mit kom-
plexeren Schaltmöglichkeiten im Laden unbe-
dingt erklären lassen und dann ausprobieren,
ob man damit auch wirklich klarkommt. Der
eine bedient einen sechsstufigen Drehschalter
à la PRS problemlos, der andere mag lieber
einen Toggleswitch (Dreiwegkippschalter à la
Gibson) plus Split-Funktion im Tone-Poti, und
der nächste braucht für seine Performance
unbedingt einen einfachen Fünfwegschalter.
(Wobei diese Dinger nur in der Handhabung
für den Musiker „einfach“ sind; unter der Haube
geht es da schon ein wenig komplizierter zu.)
Kurzum, die Sound-Auswahl und die
Bedienung sollten unbedingt zum gespielten
Stil und zur eigenen Spielweise passen. Und
das muss man schon selbst herausfinden, in-
dem man eben verschiedene Instrumente und
Elektronikbestückungen intensiv antestet.
Arne Frank
Carlos Santana bekam seine Traumgitarre gebaut – von keinem
Geringeren als Paul Reed Smith
Checkliste: Auswahlhilfe Gitarren
Spiele ich eher mit moderater Lautstärke und mit
wenig Gain/Übersteuerung und bevorzuge einen
warmen, natürlichen und eher luftigen Ton?
Dann sind Semiacoustics oder sogar Hollowbody-
Modelle für mich genau das Richtige! Vor allem
traditioneller Blues, Jazz oder Rockabilly klingen
damit schön authentisch.
Spiele ich lieber laut und/oder mit viel Gain/
Übersteuerung und möchte einen aggressiveren,
„elektrischen“ Sound mit mehr Sustain?
Hier schlägt die Stunde der massiven„Brettgitarre“!
Je lauter und verzerrter es werden soll, desto stär-
ker spielt eine Solidbody ihre Trümpfe aus.
Ist mein Klangideal laut und drahtig, aber eher
clean bis crunchy, oder möchte ich einen besonders
„effektvollen“ und spacigen Sound?
Für Spielarten wie Country, Funk, Pop aber auch
traditionelle Surf- und Space-Sounds sind leicht
gebaute Instrumente mit geschraubtem Hals und
Singlecoil-Tonabnehmern erste Wahl.
Soll mein Sound betont druckvoll, fett und singend
rüberkommen?
Dann ist es sinnvoll, sich für einen dicken, einge-
leimten Hals, einen massigen Korpus und eine
kraftvolle Humbucker-Bestückung zu entscheiden.
Zu schwer sollte die Gitarre aber nicht ausfallen,
damit man sie auch längere Zeit schmerzfrei spielen
kann.
Stehe ich auf ultraharte Riffs mit extremer Verzerrung
und/oder stimme die Gitarre tiefer als im Standard-
Tuning?
In diesem Fall ist ein Instrument mit etwas längerer
Mensur sinnvoll. Es muss keine Baritongitarre sein,
auch die ca. 20 mm längere Fender-Variante ist hier
der Gibson-typischen 628-mm-Mensur überlegen
und liefert dabei bereits einen präziseren, weniger
schwammigen Ton. Und auch die etwas technischere
und kühlere Wiedergabe aktiver Pickups hilft hier
häufig weiter.
Spiele ich hauptsächlich im Sitzen oder im Stehen?
Extravagante oder zackig geformte Solidbodys sehen
zwar auf der Bühne cool aus, lassen sich aber im Sitzen
kaum spielen. Das erschwert das Üben beträchtlich
– sofern man dabei nicht sowieso permanent vor
dem Spiegel post. Große Archtop-Gitarren wiederum
machen im Sitzen keine Probleme, können aber
je nach Statur und Haltung des Spielers im Stehen
ziemlich unbequem werden. Also: unbedingt vorher
ausprobieren, ob die Haltung bequem ist!
www.guitar.de
Gitarren Markt 2008/09
17