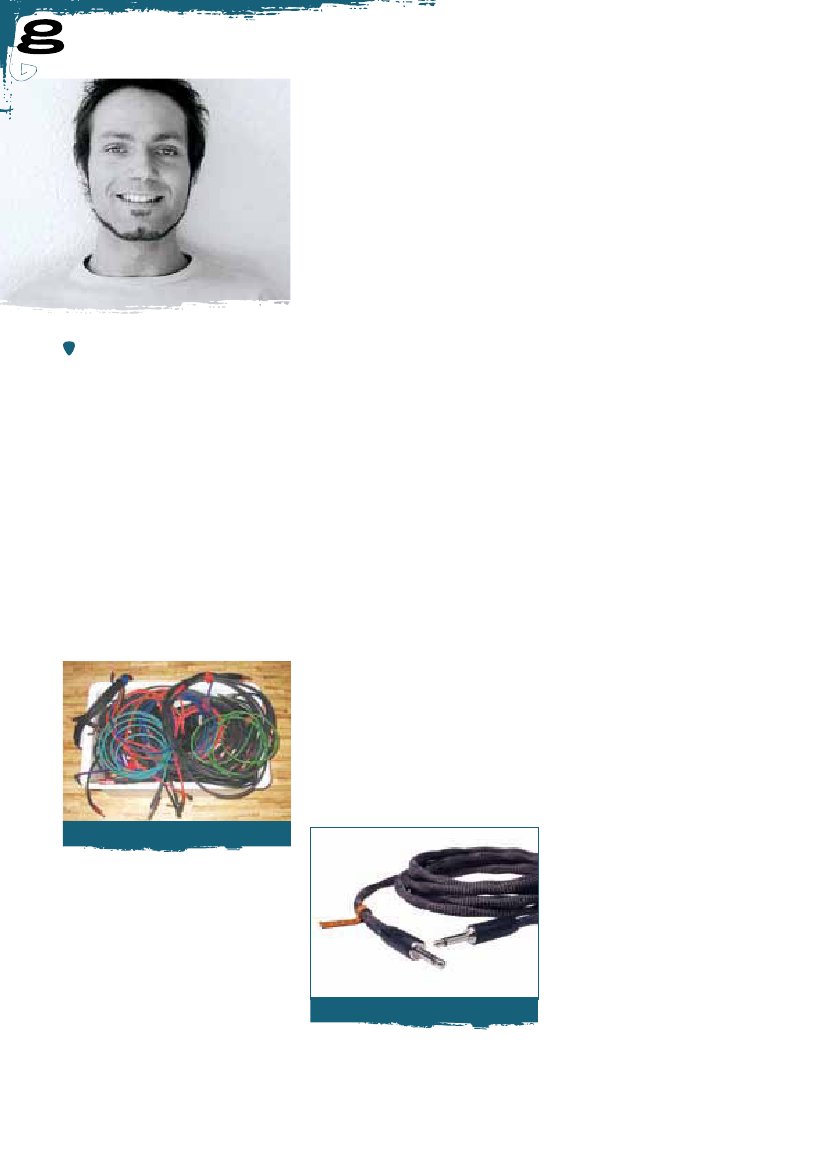© PPVMEDIEN 2009
gear
Toneguide
Klangphilosophie II:
Der Teufel im Detail
Der Equipment-Dschungel, ein üppig wucherndes, sich stets veränderndes
Sound-Territorium, ist kaum zu kartieren. Versuchen wir deshalb zumindest,
das Bewusstsein für die lauernden Gefahren zu schärfen. Eine allgegenwärtige
Bedrohung etwa ist die gemeine, signalverschlingende Kabelschlange ...
Arne Frank
Will man eine möglichst effektive Lösung
finden, sollte man ein Problem immer aus
mehreren Blickwinkeln betrachten. Nachdem wir
uns in der letzten Folge einen Überblick über die
die klangtechnische Gesamtsituation verschafft
haben, gehen wir diesmal wieder näher ran.
Denn sehr häufig steckt der sogenannte Teufel
im Detail. Und nicht selten sind es scheinbar
nichtige Kleinigkeiten, die über das Misslingen
oder den Erfolg eines Projekts entscheiden.
Natürlich ist es unmöglich, in diesem
Rahmen alle nur denkbaren Sound-Fallen und
Fehlermöglichkeiten auszuklamüsern. Aber
die Beschäftigung mit dem Thema sollte uns
dabei helfen, ein Gespür dafür zu entwickeln,
wo im Ernstfall der sprichwörtliche Hase im
Pfeffer liegen könnte. „Trouble Shooting“
nennt der Anglophile so etwas, und damit wir
dabei nicht bloß ins Blaue losballern, wollen
wir einige Beispielfälle analysieren. Am besten
fangen wir dabei mit ein paar klassischen
Missverständnissen an.
Immer wieder treten Hersteller auf den Plan und
bieten uns Musikern Kabelmaterial mit geradezu
sagenhaften Eigenschaften an. Das eine Kabel
klingt angeblich super-fett und druckvoll, das
nächste brillant und HiFi-del, und die ganz
Cleveren beschwören die ultralineare, völlig
unverfälschte Wiedergabe ihrer Produkte. Aber
was ist Mythos und was Wahrheit? Unterhält
man sich dazu mit einem Dutzend Kollegen,
erhält man ungefähr drei Dutzend Meinungen:
„Mein neues Kabel eröffnet mir ganz neue
Klangdimensionen!“, meint einer begeistert.
Ein Kollege sieht es nüchtern: „Logisch, bei
’ner ordentlich dicken Kupferstrippe geht eben
mehr Sound durch.“ Der Nächste ist dagegen
stinksauer: „Jetzt hab’ ich ein Schweinegeld für
diese gehypten neuen Kabel bezahlt – und hör
überhaupt keinen Unterschied!“
Dabei haben sie alle recht, irgendwie. Wie
geht das denn? Ja, da ist er wieder, der Teufel
im Detail. Holen wir ein bisschen weiter aus.
Offensichtlich gehen die Erfahrungswerte
beim Thema Instrumentenkabel vollkommen
auseinander. Die Überzeugten schwören auf
ihre neueste Entdeckung und sind von geradezu
missionarischem Eifer beseelt: „So gut könntest
auch du klingen, mein Bruder!“ Die Zweifler
halten das für totalen Humbug beziehungsweise
gemeine Geldmacherei, verweisen auf die
Physik und zeigen den Verfechtern den Vogel.
Was wie ein reiner Glaubenskonflikt aussieht,
hat jedoch tatsächlich einen ganz realen Bezug,
der auch noch nachweisbar ist.
Klang(ver)wandler und Filter
Ob wir es wahrnehmen oder nicht: Das
Instrumentenkabel wirkt wie ein Filter. Das
trifft im Übrigen auch auf die Tonabnehmer
unseres Instruments oder die Lautsprecher
unserer Anlage zu. Dazu muss man sich eines
unbedingt klar machen: Ein Filter kann nur
etwas filtern oder auch durchlassen, was vorher
schon da war! Wir kennen wahrscheinlich alle
den Spruch, dass ein Humbucker aus einer Strat
keine Paula macht. Was ist damit gemeint?
Nun, die akustische Fülle und Tiefe der
sustainreichen, massigen Mahagonikonstruktion
lässt sich eben nicht so einfach in eine leichte
Schraubhalsgitarre hineinzaubern.
Umgekehrt klappt das übrigens genau
so wenig. Kein noch so „luftiger“ Vintage-
Singlecoil kann aus der dicken Paula einen
knackig-schlanken Strat-Ton herausholen.
Dafür sind die rein akustischen Grundlagen
der beiden Instrumententypen, die nun
mal zuallererst von der Bauweise und der
Materialwahl abhängen, zu verschieden.
Interessanterweise erkennen selbst die meisten
technischen Hardliner an, dass die Bauform
eines rein passiven Tonabnehmers sehr wohl
deutliche Auswirkungen auf das Signal hat,
obwohl er es ja nur „passiv“ überträgt.
Noch mal zurück zum Kabel: Am zugespitz-
ten Beispiel zweier (zugegeben extremer)
Musikertypen wollen wir zeigen, warum ein
Kabelwechsel bei manchen eine Menge, bei
anderen kaum etwas ausmacht. Nehmen wir mal
an, Gitarrist X hat sein musikalisches Handwerk
sozusagen auf der Straße erlernt. Lange Jahre
hat er seine stahlbesaitete Dreadnought mit
Plektron und Vehemenz bearbeitet, um sich
und seiner Kunst im Getrampel des U-Bahnhofs
Gehör zu verschaffen. Seine charakteristische
Spielweise überträgt er natürlich auch auf
die E-Gitarre, die er neuerdings spielt. Was
will der Mann hören? Es muss knallen, das
Signal muss möglichst druckvoll und mit Biss
rüberkommen.
Wenn wir diesen Naturburschen mit einer
knackigen Solidbody-Gitarre und einem im-
pulsfreudigen Röhren-Amp zum Vergleichs-
test mit ein paar unterschiedlichen Instrumen-
tenkabeln (selbstverständlich gleicher Länge)
Vorsicht, Schlangengrube
Hilfe, mein Kabel klingt
Hä, was – wie soll denn ein Kabel klingen?
Doch wohl höchstens, wenn man drauftritt
oder die Anschlüsse auf den Boden donnert. Die
technisch Vorgebildeten bücken sich schon nach
passenden Wurfgeschossen – oha, die sind aber
leicht reizbar, heute. Gemach, liebe Diplom-
Physiker, Elektrotechniker und Anhänger des
glühenden Lötkolbens! Wir wollen schließlich
nicht die Physik aus den Angeln heben. Das ist
nämlich gar nicht nötig.
Kabel oder Klangleiter?
108
guitar 12/09
© PPVMEDIEN 2009
Toneguide
gear
+
Strat + Humbucker = Paula?
bitten, werden wir tatsächlich überraschend
deutliche Unterschiede hinsichtlich Transparenz,
Dynamik und Klangfülle zu hören bekommen.
Seine ganz eigene Spielweise produziert nämlich
eine Menge Schärfe, druckvollen Attack und
allerlei perkussive Nebengeräusche. Bringt ein
Kabel (mit hoher „Signaldurchlässigkeit“) diese
gut rüber, klingt der Junge, wie er es gern mag,
und ist zufrieden. Filtert ein Kabel hingegen die
„typischen“ Frequenzen stärker aus, wird sein
Sound matt und undifferenziert. Ein schlechtes
Kabel? Nicht unbedingt.
=
?
aber nicht annähernd so dramatisch aus wie
zuvor. Was soll das heißen? Ist Gitarrist Y
einfach der bessere Musiker? Nun, vielleicht ist
er X tatsächlich spieltechnisch überlegen, aber
eine Rolle spielt das nicht.
Die eigentliche Ursache für die so
unterschiedlichen klanglichen Auswirkungen
unserer Kabel-Testrunde liegt darin, dass
Ypsilons Spielweise gar nicht erst die metallische
Schärfe oder den aggressiven Biss erzeugt, die
man bei X so schön zur Verdeutlichung der
Filterwirkung einiger Kabel heranziehen konnte.
Noch einmal: Ein Filter kann nur filtern, was
vorher schon da war. Wir selbst erzeugen erst
mal den Ton; die übrigen Komponenten der
Signalverarbeitung und -aufbereitung können
letztlich nur darauf reagieren und bestenfalls
optimieren. Gitarrist Y kann sich also beruhigt
billige Kabel kaufen? Ja, wenn er auf erhöhte
Haltbarkeit durch eine robuste Bauweise keinen
weiteren Wert legt. Wir kommen also zu dem
Schluss: Qualitativ hochwertige, meistens
auch hochpreisige Instrumentenkabel können
dagegen besonders transparent vorkam, schei-
nen das Signal bei Gitarrist Y nun ein wenig
dünn und blechern anzuliefern. Die Chancen
stehen allerdings gut, dass das exklusive Kabel
mit der besten dynamischen Performance und
druckvollsten Wiedergabe aus Testrunde X
auch in dieser Runde ganz vorne mit dabei ist.
Insgesamt fielen die klanglichen Unterschiede
Erste Geige oder Akkordarbeit?
Unsere zweite Testperson, Gitarrist Y, wurde
von klein auf in der Musikschule nach allen
Regeln der Kunst an der Konzertgitarre und
womöglich auch an anderen klassischen
Instrumenten geschult. Er hat ein völlig
anderes Klangideal entwickelt, das er nun in
den Fingern trägt, und geht dementsprechend
völlig anders an die E-Gitarre heran. Sein
sensibler, klanglicher „Fingerabdruck“ ähnelt
eher einem Violinisten als unserem ungestümen
Akkordarbeiter von vorhin.
Unter identischen Testbedingungen kämen
wir nun höchstwahrscheinlich zu einer ganz
anderen Beurteilung der Kabelqualitäten. Was
bei Gitarrist X besonders dumpf und schlapp
rüberkam, würde bei Gitarrist Y vielleicht
ein bisschen wärmer und runder, je nach
Geschmack sogar angenehmer als die übrigen,
womöglich teureren erscheinen. Die Strippen,
deren Übertragungsqualität uns bei Gitarrist X
Ein Akkordarbeiter macht Karriere …
unserem Sound auf die Sprünge helfen, müssen
aber nicht. Das hängt in erster Linie von unserer
charakteristischen Spielweise ab.
Schluss mit dem Kabelsalat
Halten wir mal fest, was konsensfähig
erscheint: Die Dicke und die Güte des Leiters
im Kabelinneren haben Einfluss auf die
Wiedergabequalität - ein kräftiger Querschnitt
und hochwertiges, elektrisch leitfähiges Material
garantieren am ehesten, dass die Elektronen
möglichst ungehindert von einer zur anderen
Seite gelangen. Ein gewisser „Signal-Abrieb“ ist
dennoch festzustellen, der umso stärker ausfällt,
je länger die zu bewältigende Strecke ist. Auch
die Qualität der Anschlüsse ist immens wichtig.
Immerhin ist hier sozusagen die Schnittstelle
für unser Signal. Dazu kommen dann noch die
Klassische musikalische Sozialisation
109
© PPVMEDIEN 2009
gear
Toneguide
Gerade aus den genannten Gründen tun sich viele
Gitarristen, die auf größere Bühnen wechseln,
schwer mit der drahtlosen Übertragung ihres
Instrumentes. So schön die neu gewonnene
Freiheit ist, nicht länger am Kabel hängen zu
müssen, die veränderte „Anpassung“ an den
Verstärker kann zunächst ziemlich irritierend
wirken. Einige versuchen sich deshalb mit
Kondensatorschaltungen zu behelfen. Das ist
im Prinzip nichts anderes als ein fest justiertes,
zuschaltbares Tone-Poti. So etwas baute etwa
Paul Reed Smith Mitte der 80er-Jahre erstmals
als „Sweet Switch“ (später als „MVC – Mastering
Voice Control“) in seine edlen Gitarren ein, weil
ein gewisser Carlos Santana sich nicht an den
neuen „Drahtlos-Sound“, der ihm zu höhenlastig
war, gewöhnen mochte.
unerwünschten kapazitiven Dämpfungseffekte
durch die Abschirmung, die allerdings nötig ist,
damit das Kabel nicht womöglich als Antenne
fungiert und sich aus der Umgebung allerlei
Störsignale einfängt.
Fassen wir zusammen: Gute, kräftig dimen-
sionierte Leitermaterialien mit einer intelligent
aufgebauten Abschirmung, das Ganze so kurz
wie möglich gehalten plus hochwertige Stecker
garantieren eine möglichst neutrale Wieder-
gabe. Solche kapazitätsarmen Kabel machen
von ihren technischen Daten her betrachtet
mächtig Eindruck.
Also ist es das, was Musiker wollen? Jain.
Es wird immer dann schwierig, wenn man es
mit solch „unperfekten“ Instrumenten wie dem
elektrischen Bass beziehungsweise der Gitarre zu
tun hat. Deren passive magnetische Tonabnehmer
und die dazugehörigen Verstärkerschaltungen
stammen aus einer Zeit, in der eine quasi lineare,
also möglichst klangneutrale Signalübertragung
gar nicht möglich war.
Radials „Drag Control“ – gezielte
Belastung gegen Anpassungsprobleme
Carlos’ „süßer“ Minischalter für den
Sweet-Spot
Mechanische Qualität ist obligatorisch –
aber beim Sound hilft nur noch der Selbsttest
Daraus resultierten klangliche Notlösungen
und Kompromisse. Die Musiker machten
allerdings das Beste daraus und nutzten die
neuen Sounds, um ihre eigene musikalische
Ästhetik zu erschaffen. Mittlerweile haben wir
uns so daran gewöhnt, dass wir eine tatsächlich
lineare Klangübertragung unseres Instruments
nach HiFi-Standards in den allermeisten Fällen
als äußerst unbefriedigend und nichtssagend
empfinden.
Selbst die drahtlose Übertragung hat
ihre Tücken
des ursprünglichen Signals ist ja eine nicht
gerade einfache Geschichte, wie wir bereits
früheren Folgen des Tone Guide gesehen haben.
Easy Way Out?
„Geht das nicht einfacher?“, wird sich mancher
fragen, „und wieso habe ich von alldem noch
nie irgendwas bemerkt?“ Nun, dafür gäbe es
schon eine simple und einleuchtende Erklärung.
Die genannten Effekte treten normalerweise bei
einer Aktivelektronik gar nicht erst auf. Wer also
in seinem Instrument aktive Tonabnehmer oder
zumindest einen Vorverstärker (als „Booster“,
Impedanzwandler oder ähnliches) eingebaut
hat, bleibt von den besagten Schwierigkeiten
weitgehend verschont.
Dummerweise hat diese aktive Lösung ihre
eigenen Probleme, zumindest für Gitarristen.
Bassisten haben sich schon seit langem
ziemlich perfekt mit der aktiven Onboard-
Lösung arrangiert. Hier wirkt die verdichtende,
leicht komprimierte Wiedergabe einer solchen
Elektronik häufig eher vorteilhaft, weil sie
unangenehme Impulsspitzen, die beim Bass
aufgrund der viel tieferen Frequenzen heftiger zu
Buche schlagen, von vornherein abmildert. Wo
das nicht erwünscht ist, packen einige Hersteller
auch gerne noch eine zweite 9V-Batterie mit
hinein. Mit 18 Volt Versorgungsspannung lässt
sich nämlich hörbar dynamischer aufspielen.
Genau hier liegt das Problem für die
Anwendung in der Gitarre: Die Dynamik ist
eingeschränkt. Während die aktiven Pickups von
EMG oder Seymour Duncan allesamt sehr beliebt
Weg mit dem Kabel?
Das Zusammenspiel aus Gitarrenelektronik und
Kabel formt das Signal auf eine bestimmte Art
und Weise, was wiederum eine charakteristische
und sehr komplexe Reaktion des Verstärkers
hervorruft. Dazu bedarf es natürlich noch eines
Musikers, der das Instrument spielt und den
Sound auf seine Weise prägt. Diese Feinheiten
sind messtechnisch kaum zu erfassen. Für den
Musiker selbst sind sie allerdings durchaus
relevant. Sie bestimmen nämlich maßgeblich,
wie sich der Sound anfühlt. Der Zuhörer mag
davon wenig mitbekommen, der Spieler selbst
hingegen umso mehr. Gerade die „gefühlte“
Spieldynamik (nicht zu verwechseln mit dem
messbaren Dynamikumfang der übertragenden
Komponenten) entscheidet letztlich, ob wir mit
unserem Sound eins werden oder nicht. Wäre es
da nicht besser, wir könnten das Kabel einfach
loswerden? Auch das ist nicht so einfach.
Gezielte Belastung - nicht nur für Sportler
Heute gibt es dafür weitaus zielgenauere
Methoden. Die kanadische Firma Radial bie-
tet einige clevere Problemlöser, die unter an-
deren auch eine so genannte „Drag Control“
beinhalten. Das Signal wird gezielt belastet, wie
das ansonsten durch die gewohnte Signalkette
auch geschieht. Damit lassen sich dann die
typischen kapazitiven Effekte zwischen passiver
Gitarrenelektronik und Verstärker-Input sehr
exakt simulieren, selbst wenn man beispielsweise
direkt ins Pult oder den Rechner spielt. Das
wird ja im Studio immer wieder gerne gemacht,
um den passenden Verstärker erst hinterher
auszusuchen und den Gitarren-Track im „Re-
Amping“-Verfahren zu vervollkommnen. Beste
Dienste leistet Radials „Drag Control“ übrigens
auch bei Multi-Amping-Setups. Das Aufsplitten
110
guitar 12/09
© PPVMEDIEN 2009
Toneguide
gear
… Gitaristen nur bedingt
Du bist dein Sound!
Wir haben aufgezeigt, dass sich zwischen
passivem Tonabnehmer, Kabel und Verstärker-
eingang diverse physikalische Effekte abspie-
len, die das Signal hörbar beeinflussen. Davon
sind insbesondere die höheren Frequenzbereiche
betroffen. Der Sound wird auf dem Weg zum
Amp „dumpfer“ oder „wärmer“. Das hängt ganz
von der eigenen Betrachtungs- und Spielweise
ab. Nehmt euch doch mal eine Stunde Zeit
und findet selbst heraus, was ihr für ein
Kabeltyp seid. Denn euren Sound bestimmt ihr
zunächst mal selbst. Ihr selbst seid der „primäre
Klanggenerator“.
Arne Frank
Bassisten mögen’s aktiv ...
sind, wenn es um stabile Clean- oder ganz im
Gegenteil stark verdichtete High-Gainsounds
geht, stoßen sie bei Fans traditioneller semi-
cleaner bis satt crunchender Klänge auf wenig
Gegenliebe. Denn diese „klassischen“ Sounds
leben davon, dass sich die Klangfarbe, der Biss
und vor allem der Anteil der Übersteuerung
unmittelbar über die Spielweise steuern lässt.
Und das klappt eben mit einer aktiven Elektronik
nicht so gut, weil die feinen, dynamischen
Zwischenstufen fehlen. Das klingt häufig so,
als hätte man einen mild justierten Compressor
dazwischengeschaltet. Für Liebhaber klassischer
Country-, Blues- oder Roots-Rock-Klänge ist das
also ein klares Ausschlusskriterium. Da greifen
dann auch die zuvor genannten Helfer mit der
„Drag Control“ nicht, weil ein aktives System
grundlegend andere Parameter mit sich bringt.