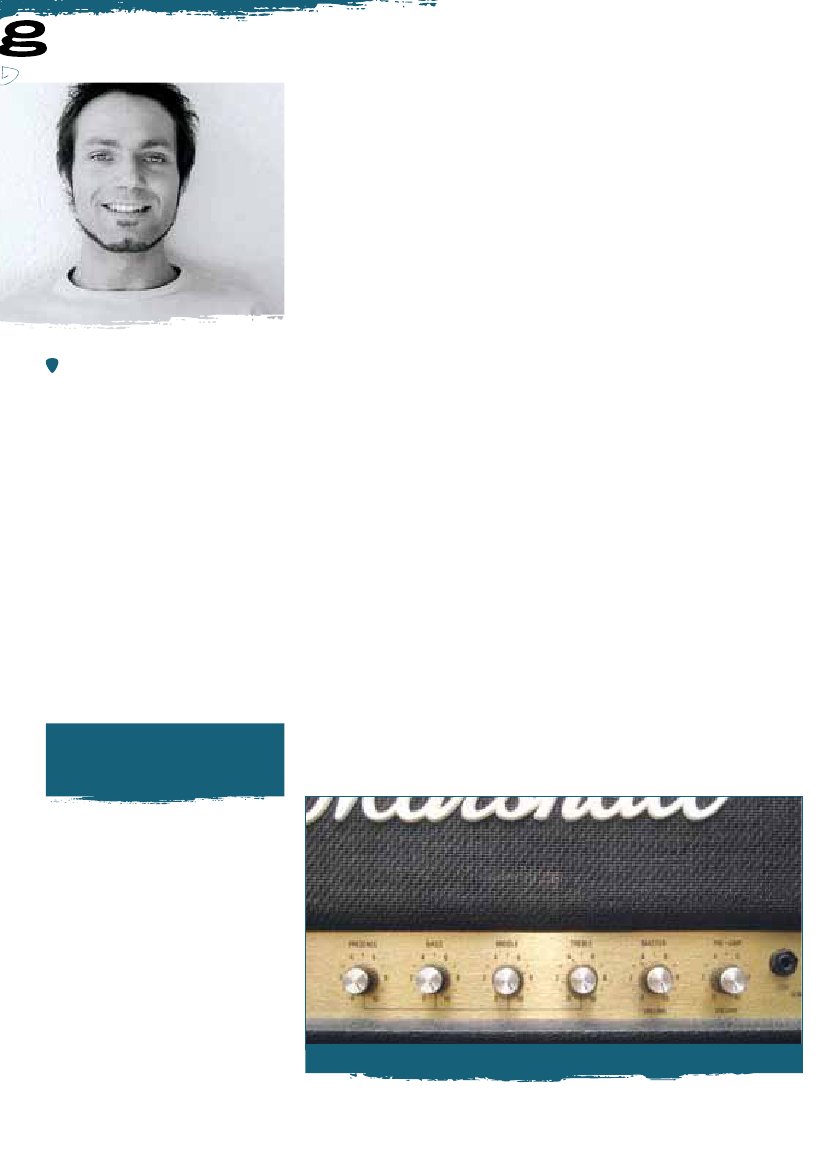© PPVMEDIEN 2009
gear
Toneguide
Klangphilosophie III:
Wer’s glaubt, wird selig ...
Nachdem wir zuletzt bereits mit einigen Missverständnissen und überlieferten
Irrtümern aufgeräumt haben, nähern wir uns nun gewissermaßen dem Gebiet
der Kryptozoologie: Yetis, Loch-Ness-Monster, die gravitationslose Sumpf-
esche, Van Halens Marshall-Tuning und ähnlich sagenhafte Phänomene stehen
ab sofort auf dem Prüfstand.
Arne Frank
Der menschliche Forschungsdrang kennt
bekanntlich keine Grenzen. Und je obskurer
etwas ist, desto spannender und faszinierender
wirkt es. Das bescherte durchaus nicht nur „Akte
X“ großartige Einschaltquoten, sondern auch so
mancher mehr oder weniger wissenschaftlich
fundierten Dokumentation. Wir alle lassen uns
natürlich gerne beeindrucken von Dingen, die
man kaum für möglich hält.
Von der Faszination zu purer Fantasie ist der
Weg allerdings kurz. Immer schön vorsichtig
also, denn das Eis wird dünner! Und das liegt in
unserem Fall nicht an der globalen Erwärmung,
die nicht nur den Eisbären das Überleben
zunehmend erschwert, sondern am mysteriösen
Charakter so mancher Halbweisheit.
steuert die Treiber- oder Phasenumkehrstufe an
und wird durch die Endstufenröhren gepumpt.
Je weniger Bauteile dabei im Signalweg liegen,
desto unmittelbarer und dynamischer ertönt
das Gitarrensignal aus den angeschlossenen
Lautsprechern.
Das ist für gewisse Sound-Vorstellungen
zwischen Blues und Retro-Rock ideal und gilt
hier deshalb als das Maß aller Dinge. (Das
erklärt wohl auch die derzeitige Renaissance
möglichst puristischer Verstärkerschaltungen.)
Dreht man die passive EQ-Sektion zu, wird das
Signal immer leiser, bis schließlich nichts mehr
herauskommt. Schließlich arbeiten die Regler
passiv, können also nur die ihnen zugewiesenen
Frequenzbereiche ausfiltern. Macht man alle
Filter zu, geht auch nichts mehr durch.
Am besten alle Regler auf
Unbedarfte Einsteiger werden von erfahrenen
Gitarristen mitunter in die Geheimnisse des
„ultimativen Sounds“ eingeweiht. Immer wie-
der gern genommen wird zum Beispiel die so
genannte „britische Einstellung“: Dabei geht
No pain, no gain?
Nun waren die rockenden Pioniere der Sixties
und Seventies in Sachen Gain nicht gerade
verwöhnt. Die ersten urtümlichen Verzerrer- und
Booster-Pedale waren zwar bereits im Umlauf,
aber technisch noch nicht sonderlich ausgereift
und fürs einfache Gitarristenvolk auch nicht so
ohne weiteres zugänglich. Die Produktion von
High-Output-Pickups kam erst Mitte der 70er
so richtig in Fahrt. Und „High-Gain“ aus einer
kaskadierten Vorstufenschaltung wartete darauf,
erst noch vom „Boogie-Man“ Mr. Randall
Smith entdeckt zu werden. Eine nennenswerte
Übersteuerung erzielte man demnach nur mit
der bis zum Kragen aufgerissenen Endstufe des
Verstärkers. Insofern brauchte man selbstredend
jedes Quäntchen „Gain“, das die Schaltung zu
leisten imstande war.
Waren die Potis in der Vorstufensektion nicht
weit genug auf, war’s nichts mit Overdrive.
In dieser Zeit hieß es verständlicherweise
„Signalpegel um jeden Preis“. So behalfen sich
viele Gitarristen damit, konsequent alle Regler
voll aufzureißen. Großbritannien war damals
mit dem Aufkommen des British Psychedelic
Blues (Yardbirds, Cream, Peter Greens Fleetwood
Mac) beziehungsweise etwas später des Proto-
Hardrocks (Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep
Purple) tonangebend für die populäre Musik.
Tortur für Amp und Ohr
So wurde dieses einfache, von Musikern selten
in Frage gestellte Verfahren als „britische Ein-
stellung“ bekannt. Diese stand so ganz sicher
niemals im Handbuch der Hersteller, fordert
sie doch sämtlichen Bauteilen das Äußerste
ab. Man stelle sich nur mal vor, wie lange ein
Auto halten würde, das permanent im roten
Darin steckt
ein Körnchen Wahrheit
es zum Glück nicht um die Verteidigung der
von Europolitikern als überflüssig erachteten
Währung oder eine politische Gesinnung,
sondern um die Justierung der Regler am
Verstärker. Angeblich klingen traditionell
gebaute britische Röhren-Amps (Hiwatt,
Marshall, Laney) grundsätzlich am besten,
wenn man alle Regler voll aufdreht.
Wie bei den meisten Mythen steckt darin
ein Körnchen Wahrheit. Der Rest ist purer
Nonsens. Versuchen wir also das eine vom
anderen zu trennen. Ein klassisch aufgebauter
Röhrenverstärker unterscheidet sich von den
meisten modernen Schaltungsdesigns durch
eine ziemlich geradlinige, schnörkellose
Signalverarbeitungskette. Das Signal kommt in
den Amp, wird kurz aufbereitet beziehungsweise
vorverstärkt, durchläuft die Klangregelung,
Die britische Flat-out-Einstellung … macht Ohrensausen
92
guitar 01/10
© PPVMEDIEN 2009
Toneguide
gear
Aber glaubt nicht mir, fragt ein paar Saitenpromis, die für ihren
beeindruckenden Sound berühmt sind: Gestandene Gitarrenhelden wie
beispielsweise AC/DCs Angus Young oder Klangtüftler Eric Johnson
haben schon lange festgestellt, dass sich ein mit Gefühl justierter, maßvoll
aufgedrehter Marshall wesentlich besser anhört als das berüchtigte
„Alles-voll-auf-Setting“. Es kommt eben immer auf die richtige und
feine Dosierung an.
Brown Sound oder braune Grütze?
Nur ein kleiner Sprung ist es vom vorigen Abschnitt zu einem Mysteri-
um, das immer wieder die Gemüter bewegt – Eddies viel gepriesener,
so genannter „Brown Sound“ auf den frühen Van-Halen-Alben. Der
Legende nach soll der (erwiesenermaßen experimentierfreudige) junge
Tapping-King nämlich seine ollen Plexi-Marshalls mit einem fiesen
technischen Trick zu mehr Gain und Verzerrung angestachelt haben.
Dazu habe er, so munkelt man, seine Amps mit einem „Variac“ (steht für
„variable AC“, einer Art Dimmer) verbunden, um die Spannung zu erhöhen.
Das klingt für den technisch Unbewanderten zunächst mal gar nicht so
falsch. Die dahinter stehende, vermeintliche Kausalkette dürfte etwa so
aussehen: Ein Verstärker braucht Strom, damit ordentlich Saft zu den
Lautsprechern kommt, okay. Mehr Strom heißt dann doch automatisch
mehr Saft, also geilerer Sound, ist doch logisch, oder?
Leider nicht. Nun hört und liest man immer wieder davon, dass eine
erhöhte Spannungsversorgung gerade bei Röhrenschaltungen ja so viel
besser sei. Das ergäbe weniger Nebengeräusche, eine bessere Dynamik,
einen tolleren Sound und so weiter.
Im Prinzip stimmt das sogar, und manche Amps klingen wirklich besser,
wenn die Röhren (ausschließlich von einem sachkundigen Techniker!) auf
den klanglich idealen Arbeitspunkt gebracht werden. (Viele Hersteller
fahren ihre Verstärker nämlich ab Werk gerne etwas zu „kalt“, also
mit geringerer Spannung, um die Lebensdauer der Röhren zu erhöhen,
beziehungsweise Ausfälle während der Garantiezeit zu vermeiden.) Nun
kann man aber nicht grundsätzlich einfach so die Spannung hochjagen,
ohne genau zu wissen, was man da tut, und meinen, damit wäre es getan.
Starker Sound – aber bitte mit Gefühl
Drehzahlbereich gefahren wird … Erstaunlich genug, dass die Verstärker
diese Tortur meistens so gut überstanden haben – besser jedenfalls als
die zugehörigen Lautsprecher, die, ebenso wie die Endstufenröhren, bei
tourenden Profis regelmäßig ausgetauscht werden mussten.
Mit dem Aufkommen von Verstärkern mit Master-Volume, erweiterten,
teilweise mehrkanaligen Vorstufenschaltungen und integrierten Boost-
und Overdrive-Sektionen verlor das Ganze allmählich an Bedeutung.
Moderne Verstärker sind meistens deutlich flexibler und somit auch
komplexer aufgebaut, in jedem Fall aber ganz anders abgestimmt. Sie
leisten eben gerade nicht ihr Bestes, wenn man wahllos alles bis zum
Anschlag aufreißt! Und selbst bei einem traditionellen Röhren-Amp sollte
man die vorhandenen Regelmöglichkeiten nutzen, um den Sound optimal
auf die eigene Spielweise und die Gitarre abzustimmen. Alles andere ist
nicht nur eine Tortur für den Amp, sondern auch für die Ohren.
High Voltage Rock’n’Roll
Jeder Verstärker ist vom Hersteller für eine bestimmte Betriebsspannung
vorgesehen, und die Bauteile müssen entsprechend darauf abgestimmt
sein. Verpasst man jedoch wahllos einer Schaltung, die dafür überhaupt
nicht vorgesehen ist, eine Überspannung, riskiert man unweigerlich, dass
da etwas abraucht. Außerdem bedeuten verbesserte dynamische Werte
© PPVMEDIEN 2009
gear
Toneguide
High Voltage – für mehr Headroom
tatsächlich mehr „Headroom“, also gerade weniger „Overdrive“. Das stünde
dem eigentlichen Ansinnen nach einem fetteren, stärker übersteuerten
Sound natürlich völlig entgegen. Dazu sei am Rande erwähnt, dass
sich die höchsten Spannungen für Röhrenschaltungen in spezialisierten
Bassverstärkern finden. Ratet mal, warum ...
Wer mehr Gain und Kompression sucht, müsste also die Spannung
herunterfahren, nicht anheben! Tatsächlich finden sich entsprechende
Schaltungen zur dosierten Spannungsreduzierung in einigen modernen
Verstärkern. Zum Beispiel bei Mesas „Dual-Rectifier“-Serie, die hierfür
einen Spongy/Bold-Schalter einsetzt. Die Wirkung ist entsprechend:
In Position „Spongy“ (wörtlich: „schwammig“) wird der ansonsten
superstraff und knallhart abgestimmte moderne Metall-Brüller mit
reduzierter Voltzahl gefahren. Er übersteuert dadurch etwas früher, vor
allem wirkt er jedoch geschmeidiger und weniger rabiat, also insgesamt
etwas traditioneller.
Richtig deutlich werden diese Unterschiede allerdings auch nur bei
realistischen, sprich etwas höheren Arbeitspegeln. Wenn unser Eddie
wirklich mit dem Dimmer herumgespielt hat, dann jedenfalls, um die
Spannung zu reduzieren, nicht um sie hochzufahren. Aber bitte, liebe
Hobby-Eddies – niemals solche Experimente wagen, wenn ihr kein
ausgebildeter Techniker seid! Das planlose Herumfuhrwerken in einem
Röhrenverstärker ist nämlich unter Umständen a) sehr teuer und b)
lebensgefährlich!
Schlank im Trend
Trends sind faszinierend. Erst wird vehement eine Extremform gepredigt,
und (fast) alle glauben daran und rennen dem neuesten angesagten
„Wundermittel“ hinterher. Doch einige Zeit später drehen sich die
Vorzeichen plötzlich um, und alles geht genau in die andere Richtung.
Derzeit geht der Trend bei Solidbody-Gitarren in die Richtung: je leichter,
desto besser.
In Internet-Foren und anderen Portalen liest man davon, wie viel
besser leichte Instrumente klingen, schwingen, resonieren, um nicht
zu sagen „jubilieren“, wenn man nur sanft darüber hinweg streicht.
Zugegeben, ein leicht gebautes Saiteninstrument ist rein physikalisch
betrachtet leichter in Schwingung zu versetzen als ein vergleichbar
schweres Exemplar. Es wird schlichtweg weniger Energie benötigt, um die
geringere Masse anzuregen. Gleichzeitig wird die Schwingungsenergie
auch schneller absorbiert: Das Ganze klingt nicht so lange nach wie ein
massigeres Stück Holz. Wahre Sustain-Monster sind daher eher unter den
schwereren Kandidaten zu suchen.
Klingt demnach eine leichte E-Gitarre automatisch besser? Nein, denn
das hängt von ganz verschiedenen Faktoren ab, die nur bedingt mit dem
Instrument an sich zu tun haben. In der letzten Folge haben wir ja bereits
geschildert, dass der Spieler oder die Spielerin selbst den Sound mit ihrer
jeweiligen Spieltechnik ganz entscheidend prägen. Damit geht es aber erst
los. Wie laut gespielt wird, welcher Stil gefragt ist und welchen Platz die
Gitarre im klanglichen Gesamtgefüge einnehmen soll, all das ist ebenso
entscheidend.
Ist ein luftiger, knackiger Sound angesagt, ist ein leichtes Instrument
im Vorteil. Für stärker verzerrte Klänge ist zum Beispiel die extrem
beliebte „gravitationslose“ Sumpfesche aber nicht unbedingt das Gelbe
vom Ei, sofern das nicht anderweitig (zum Beispiel durch die eingebaute
Elektronik) kompensiert wird. Es kommt leider allzu häufig vor, dass sich
jemand solch eine federleichte Swampash-Gitarre vom Mund abspart,
nur um dann festzustellen, dass sich das neue „Spielzeug“ mit dem
„masselosen“ Sound im spezifischen musikalischen Umfeld schlichtweg
nicht durchsetzen kann.
Mehr Kompression und geschmeidiges Gain mittels „Spongy“-Switch
Der „easy way out“
Soll es also wuchtiger, druckvoller, aber eher warm und „organisch“
klingen, kommt eine massigere Konstruktion mit „ordentlich was auf
den Rippen“ besser weg. Da kommt der Schub gewissermaßen aus dem
Holz. Wird hingegen tief heruntergestimmt oder ist ein aggressiver,
scharf artikulierter Ton bei maximaler Distortion-Intensität gefragt, ist
94
guitar 01/10
© PPVMEDIEN 2009
Swampash: Schwingungswunder oder Luftschloss?
man wiederum mit einer leichteren Gitarre
mit kräftigen Pickups besser dran. In diesem
Fall hört man weniger vom Holz und dafür
umso mehr vom Wiedergabecharakter der
Tonabnehmer.
Das ist im Grunde
der „easy way out“;
einige Hersteller ge-
ben sich allerdings
erheblich mehr Mühe.
Die superleichten Par-
ker-Modelle zum Bei-
spiel sind in Sachen Masse aufs Nötigste
reduziert, klingen aber dennoch ausgewogen,
weil das System als Ganzes entsprechend
abgestimmt ist. Okay, wie wir schon hieran
sehen, sind die beschriebenen Fälle natürlich
allesamt starke Vereinfachungen, die jetzt nicht
die zahlreichen Zwischenstufen berücksichtigen.
Aber es sollte zumindest in einigermaßen
nachvollziehbarer Weise eine sinnvolle Rich-
tung vorgeben. Daher mein ernstgemeinter
Ratschlag: Nicht mit der Feinwaage einkaufen
Nicht alles besteht
den „reality check“
gehen, sondern lieber mit gespitzten Ohren. Das
ist mit Sicherheit effektiver.
Um es mit ein paar oft gehörten, aber
leider schmerzhaft wahren Worten zu sagen:
Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und nicht
alles, was gemeinhin
als erwiesen hinge-
nommen wird, besteht
auch den „reality
check“. Es lohnt sich
also, die überlieferten
Sagen und Mythen
ruhig mal zu hinterfragen.
Insbesondere bevor man sich in einem
Anfall von G.A.S. (Gear Acquiring Syndrome)
neues Equipment anschafft oder das bestehende
irgendwelchen exotischen bis esoterischen Pro-
zeduren unterzieht. Duscht lieber mal kalt,
macht ein paar Yoga-Übungen oder was immer
euch hilft, um einen klaren Kopf zu bekom-
men. In der Zwischenzeit bau ich meine Yeti-
Falle fertig …
Arne Frank
She’s so heavy – aber vielleicht genau das Richtige für mich